BMF konkretisiert Abzug von Unterhaltsaufwendungen an im Ausland lebende Personen
BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2025

Mit Schreiben vom 15. Oktober 2025 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die bisherigen Grundsätze zur steuerlichen Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen an im Ausland lebende Personen überarbeitet.
Anlass ist die Änderung des § 33a Abs. 1 EStG durch das Jahressteuergesetz 2024, wonach Unterhaltsleistungen künftig nur noch abzugsfähig sind, wenn sie durch Überweisung auf ein Konto der unterstützten Person erfolgen.
Das neue BMF-Schreiben ersetzt das bisherige Schreiben vom 6. April 2022 (BStBl I 2022, 623) und gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2025.
Die Änderungen betreffen viele Steuerpflichtige, die Angehörige im Ausland unterstützen – etwa Eltern, Ehegatten oder Geschwister –, und führen zu strengeren Nachweis- und Dokumentationspflichten.
1. Gesetzlicher Hintergrund
Nach § 33a Abs. 1 EStG können Steuerpflichtige Aufwendungen für den Unterhalt bedürftiger Personen als außergewöhnliche Belastung abziehen, wenn diese Personen gesetzlich unterhaltsberechtigt sind.
Dies gilt auch für Unterhaltszahlungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland, allerdings unter besonderen Nachweisvoraussetzungen.
Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde ein neuer Satz 12 in § 33a Abs. 1 EStG eingefügt:
„Der Abzug von Unterhaltsleistungen in Form von Geldzuwendungen ist nur möglich, wenn die Zahlung durch Überweisung auf ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt.“
Damit wird klargestellt, dass Barzahlungen, Bargeldtransporte oder unklare Geldflüsse künftig nicht mehr anerkannt werden.
2. Berechtigte und nicht berechtigte Unterhaltsempfänger
Nach dem BMF-Schreiben können Unterhaltsaufwendungen nur berücksichtigt werden, wenn der Empfänger nach deutschem Recht unterhaltsberechtigt ist.
Dazu zählen insbesondere:
- Eltern, Großeltern und Kinder (soweit kein Anspruch auf Kindergeld besteht),
- Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner,
- weitere Verwandte in gerader Linie.
Nicht begünstigt sind:
- Kinder, für die Kindergeld oder Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG bestehen,
- Ehegatten, für die bereits ein Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG vorgenommen wird,
- Personen, die nur nach ausländischem Recht unterhaltsberechtigt sind.
Damit wird der persönliche Anwendungsbereich gegenüber dem Schreiben von 2022 bestätigt, aber an einigen Stellen präzisiert.
 3. Nachweispflichten und erhöhte Mitwirkungspflicht
3. Nachweispflichten und erhöhte Mitwirkungspflicht
Wer Unterhaltsleistungen ins Ausland geltend machen will, trägt die volle Feststellungslast.
Das bedeutet: Der Steuerpflichtige muss die Bedürftigkeit und den tatsächlichen Zufluss der Zahlungen zweifelsfrei nachweisen (§ 90 Abs. 2 AO).
Eigenbestätigungen oder eidesstattliche Versicherungen genügen nicht.
Erforderlich sind regelmäßig:
- Zweisprachige Unterhaltserklärungen,
- amtliche Bestätigungen der Heimatbehörde,
- Nachweise über eigene Bezüge und Vermögen der unterstützten Person,
- ggf. Übersetzungen durch vereidigte Dolmetscher (Kosten hierfür sind nicht abzugsfähig).
Nur wenn in Krisen- oder Kriegsgebieten keine amtlichen Bescheinigungen erhältlich sind, können ausnahmsweise Beweiserleichterungen greifen.
4. Neue Regelung: Nachweis von Geldzuwendungen
Der zentrale Punkt der Neufassung betrifft die Art des Zahlungsnachweises:
Ab 2025 sind Unterhaltsleistungen nur noch abzugsfähig, wenn sie durch Überweisung auf ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgen (§ 33a Abs. 1 Satz 12 EStG).
Zulässige Nachweise:
- Kontoauszüge oder Buchungsbestätigungen mit Namen des Empfängers,
- Überweisungen auf Konten, die eindeutig dem Unterhaltsempfänger zugeordnet sind,
- Zahlungen über anerkannte Zahlungsdienstleister (z. B. Transferdienste) – sofern das Geld auf dem Konto des Empfängers eingeht.
Nicht anerkannt:
- Barzahlungen oder Bargeldtransfers,
- digitale Geldbörsen (E-Wallets) ohne Kontoanbindung,
- Überweisungen an Dritte, es sei denn, es handelt sich um einen abgekürzten Zahlungsweg, z. B. Zahlung der Miete direkt an den Vermieter der unterstützten Person.
Beispiel:
Ein Steuerpflichtiger überweist die Miete seiner Tochter im Ausland direkt an den Vermieter.
Die Zahlung ist abzugsfähig, wenn die Mietverpflichtung der Tochter nachweislich besteht.
5. Unterhaltserklärung und Erwerbsobliegenheit
Zur Prüfung der Bedürftigkeit ist eine Unterhaltserklärung zwingend erforderlich.
Diese muss Angaben enthalten über:
- das Verwandtschaftsverhältnis,
- persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf),
- Haushaltsangehörige,
- Einkünfte, Vermögen und sonstige Unterstützungen.
Bei Personen im erwerbsfähigen Alter prüft die Finanzverwaltung zusätzlich, ob sie ihrer Erwerbsobliegenheit nachkommen.
Grundsatz: Wer arbeiten kann, muss seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten.
Nur bei Altersrente, Krankheit, Behinderung, Studium, Kinderbetreuung oder Pflege naher Angehöriger kann von dieser Pflicht abgesehen werden.
6. Aufteilung und Beteiligung mehrerer Unterstützer
Werden mehrere Personen gemeinsam unterstützt, ist der Gesamtbetrag gleichmäßig auf alle Haushaltsmitglieder aufzuteilen.
Dabei gilt:
- Nur Unterhalt an begünstigte Personen ist abziehbar.
- Zahlungen für nicht begünstigte Personen (z. B. Kinder mit Kindergeldanspruch) sind zu kürzen.
- Unterstützen mehrere Steuerpflichtige dieselbe Person, steht jedem ein anteiliger Höchstbetrag zu (§ 33a Abs. 1 Satz 7 EStG).
Sind Mitunterstützer nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, werden deren Beiträge bei der Aufteilung nicht berücksichtigt, sondern als Bezüge der unterstützten Person behandelt.
7. Zeitraum und Höchstbeträge
Der Grundhöchstbetrag nach § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG beträgt 12.096 Euro (Stand 2025).
Er mindert sich:
- zeitanteilig, wenn nicht das ganze Jahr über Zahlungen geleistet wurden,
- je nach Ländergruppe, je nach Lebenshaltungskosten des Empfängerstaats.
Beispielhafte Kürzungen:
- Ländergruppe 1: keine Kürzung (z. B. EU-Staaten),
- Ländergruppe 2: ¾ des Höchstbetrags,
- Ländergruppe 3: ½,
- Ländergruppe 4: ¼ des Höchstbetrags.
Zahlungen gelten im Monat des Abflusses als geleistet (Zeitpunkt der Belastung auf dem Konto).
8. Anrechnung eigener Bezüge
Bezüge und Einnahmen der unterstützten Person – z. B. Rente, Arbeitslohn oder sonstige Einkünfte – mindern den abziehbaren Betrag.
Hierbei sind zu berücksichtigen:
- Kostenpauschale von 180 Euro,
- ggf. Werbungskosten-Pauschbetrag bei Renten,
- Umrechnung ausländischer Beträge in Euro (§ 33a Abs. 1 S. 8 EStG).
Nur der nach Anrechnung verbleibende Betrag ist als außergewöhnliche Belastung abziehbar.
9. Opfergrenzenregelung
Auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen wird begrenzt berücksichtigt.
Nach der sog. Opfergrenze sind Unterhaltsleistungen nur abzugsfähig, soweit sie zumutbar sind.
Der zumutbare Prozentsatz liegt in der Regel zwischen 20 % und 30 % des Nettoeinkommens und wird um 5 %-Punkte je im Haushalt lebenden Ehegatten oder Kind reduziert.
Diese Regelung schützt Steuerpflichtige davor, durch zu hohe Unterstützungsleistungen selbst in finanzielle Not zu geraten.
10. Anwendung und Geltung
Das Schreiben gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2025 und ersetzt das BMF-Schreiben vom 6. April 2022 (BStBl I 2022, 623).
Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und ist verbindlich für alle Finanzämter.
07.11.2025 - Daniel Eilenbrock
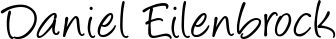
Auf Twitter teilen Auf Facebook teilen
Ihre Bewertung, Kommentar oder Frage an den Redakteur
Haftungsausschluss - Die EMH News AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Empfehlungen sowie für Produktbeschreibungen, Preisangaben, Druckfehler und technische Änderungen. (Ausführlicher Disclaimer)





